laut.de-Kritik
Hi-Fi fürs Herz.
Review von Franz Mauerer2018 – ungewöhnlich jung für einen Meilenstein. Advance Base aka Owen Ashworth war früher mal, bis zu einem Hörschaden, auch solo als Casiotone for the Painfully Alone ein Pionier eines teils wuchtigen elektronischen Songwritertums mit direkten Nachfahren wie James Blake. Dann musste er leiser spielen, weil die Birne sonst brannte, und hat als Advance Base zu diesem Zeitpunkt schon zwei sehr gute Alben unter seinem neuen Moniker veröffentlicht. 2012 kam "A Shut-In's Prayer", 2015 folgte "Nephew in the Wild", beide mit sehr guten Kritiken. Und seitdem ist der gute Mann kaum schlechter geworden (sowohl "Wall of Tears & Other Songs I Didn't Write" als auch "Horrible Occurrences" sind empfehlenswert).
Aber sein drittes Werk "Animal Companionship", dieses unrunde Ding, das löst etwas in einem aus. Die intimen Geschichten, die oft Tierfiguren als Metaphern benutzen, die lassen partout nicht mehr los. Ein Album, zu dem man immer wieder zurückkommt, wenn man weinend um drei Uhr nachts von der Stammkneipe nicht nach Hause gehen will, wenn die Beförderung ausbleibt, insgesamt eher weniger bei freudigen Anlässen. Nichts gegen Gutwetterfreunde, aber zählen nicht "Songs Of Love & Hate" und "The Boatman's Call" umso mehr, weil sie da sind, wenn sich alle anderen vor Abscheu und peinlichem Berührtsein abwenden?
"Animal Companionship" wendet sich nicht ab, das ist der ganze Sinn des Albums, von dessen Cover einen der liebe Hund Walter doof anglotzt. Es ist einfach da, und es hört sich immer so an, als ginge es Owen mindestens so schlimm wie dir, und als wüsste er das auf einer tieferen Ebene als du. Er kommt übrigens auch überhaupt nicht klar, es geht nicht ums Aufbauen. Ashworth wäre der Typ, der bei einer Party sagt: "Aber die Kinder im Südsudan?" Damit hätte er natürlich fast immer recht, und so akzeptiert man halt, wie weh einem das alles tut, und hört "Animal Companionship", weil es dann wenigstens zusammen schmerzt.
Das hier ist übrigens gar nicht wirklich Lo-Fi, es hört sich nur so an: Tatsächlich ist es das erste Album, das Ashworth in einem Studio aufnahm und dass er co-produzieren ließ (was er seitdem beibehielt). Für ihn war es also relatives Hi-Fi. Das hört man raus, weol der Sänger nie kokettiert, sondern mit seinen sanften Drones und dem stets den Gesang umspielenden Piano immer alles gibt in diese Kuscheldecke aus Synths und Steel Guitar. Das Wiegende und die perkussive Kraft ("Walt's Fantasy"!) der alten Keyboards braucht man nicht minder, es bildet den ständigen Kontrapunkt zum den unvorbereiteten Hörer inhaltlich fast schon in die Apathie treibend traurigen Album.
Somit zurück zu den Tieren: Auf dem exzellenten Opener "True Love Death Dream" beginnt das Album mit einem Tusch und deutete eine John Grant-Grandezza an, die ihm nicht fremder sein könnte. Tatsächlich ist das immer noch der glitzerndste Song, der sein Funkeln aber schnell repetitiv werden lässt und einen Vorhang lüftet, hinter dem Verlust eines lieben Menschen wartet, konterkariert durch das Überleben eines nach dem Liebsten benannten Haustiers. Das ist dann auch der erste Akt für Ashworths wirklich einzigartiges Organ, mehr krächzend als singend und immer wahnsinnig vorsichtig spricht er: "A month after you left for school / He crashed his van and he was killed".
"Dolores & Kimberly" und "Your Dog" sind vielschichtige Reflektionen übers Verlassen und Verlassenwerden ("Jesse gave me the divorce / When I turned 34 / I just can’t see the kids anymore" vs. "I swear that there were some days / It felt like I was only / Coming around for your dog"), vor allem von der faden Begeisterung, neu anzufangen. Ashworth haucht "Dolores" enorm viel Soul ein, zusammen mit dem billig stampfenden Loop ergibt sich eine einzigartige Athmosphäre. "Your Dog" dagegen bleibt im Drone bleak, unsicher und feindselig, wie immer umgekehrt passend zu den versöhnlichen, akzeptierenden Lyrics.
"Christmas In Nightmare City" reiht sich ein in die schrägen Weihnachtslieder von Ashworth. Zu einem wunderschönen Piano spricht er über seinen eigenen Alkoholentzug, während er Gary, Indiana, im Vorbeifahren lobt, um sich abzulenken. Einen Coversong gibt es auf der Scheibe, der schält aus dem viel zu hektischen "You & Me & the Moon" von The Magnetic Fields das tolle Kernelement heraus, das dort verschüttet ging. Ein Fremdkörper ist es nicht, dafür zieht er das Stück viel zu entschlossen zu sich, man merkt am melodischen Refrain aber ebenso wie an den nicht abgrundtiefen Texten, dass hier was nicht recht stimmt.
Bei "Rabbits" führt eine verbitterte Ex namens Lily ihren Hund aus, nur um scheinbar Jahre nach der Trennung noch mit strikter Härte gegen sich selbst nur das Leben des Ex ("Michael") auszumalen, gefangen in den Erinnerungen an ihn in einer Stadt, die er längst verließ. Die windschiefen, wunderschönen Synthie-Vorhänge des Songs vor dem Schlagzeugspiel errichten eine Höhe, die einen bei jedem Hören wieder zittern lässt. Das Highlight eines Highlight-Albums. "Same Dream" hält das Niveau fast, alleine schon aufgrund der fast nie vorkommenden Besingung einer Schwangeren, die davon träumt, ihr Kind nicht in New York, sondern auf dem Land zu gebären, aber ihre Schwangerschaft auf sich gestellt bestreitet.
Ashworths Sozialstudien haben nichts Voyeuristisches, sondern eine einnehmende Menschlichkeit. Wer sonst könnte wie auf "Answering Machine" einen Hund besingen, der sein Spielzeug neben dem AB liegen lässt, auf den seine Besitzerin (wieder "Lily"!) für ihn aufspricht? Ein schöneres Liebeslied als "Care" kennt die Menschheit wohl kaum. Die beiden Alten retten sich vor einem Hausbrand, nehmen natürlich den Hund mit ("Get the dog we can leave the rest") und er sinniert dabei über sein Leben mit ihr, über keine Sessel, keinen Tresor, keine Urkunden, nur darüber, wie sie ihm über die Jahrzehnte beistand.
Jason Quever, bekannt aus seinem Soloprojekt Papercuts, ist Co-Produzent und Drummer. Eine ganze Truppe an bemerkenswerten Musikern und Künstlern arbeitete hier mit, angefangen beim tollen Cover, das Jessica Seamans malte, und Dan Black von den tollen Black Mass, die gerade etwas Aufmerksamkeit bekommen, weil sie mit Minus The Bear touren, designte. Klavier spielte die solo viel zu unbekannte Gia Margaret, Gitarre spielte unter anderem Peter Gill von der Band Friendship. Es erinnert fast schon an Mark Kozelek, wie Quever hier absolute und ziemlich unter dem Radar fliegende Vollprofis versammelt. Ashworth tourt oft solo mit Keyboard, wenn man nicht im nördlichen Osten Nordamerikas lebt, wird man ihn aber wohl verpassen.
In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.





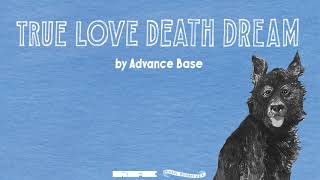







Noch keine Kommentare